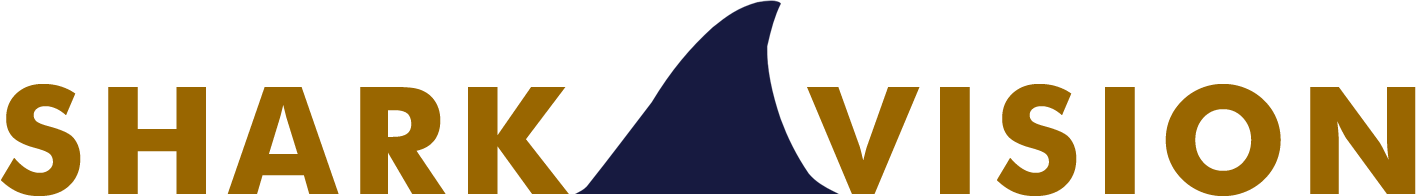Der heutige Preisschock ist nicht nur auf das Covid-Konjunkturprogramm und den Krieg zurückzuführen. Im Jahr 2017 haben wir im Trend Fm (Budapester Radiosender) über Inflation gesprochen.
Dass der Druck zunimmt, hätte jedem Wirtschaftswissenschaftler, der nicht völlig blind oder nicht zum Dienst der Politik angetreten war, spätestens 2018 klar sein müssen.
Das Interview wurde am 02.03.2017 aufgezeichnet.
Reporter: In den letzten anderthalb Jahren haben Europa und fast die ganze Welt vor deflationären Tendenzen gezittert. Im Gegenzatz dazu scheint doch jetzt die Inflation zu klettern. In den letzten Monaten kamen wieder so hohe Zahlen zur Teuerung, die früher nur einige gedacht hätten. Welche Richtung schlagen wir denn ein?
Kornel Sarkadi-Szabo: Ich würde es so ausdrücken, es gab Inflationswerte, die die Erwartungen wohl übertroffen haben. Um die Frage zu beantworten, lohnt es doch sich, einen Blick auf die Vorgeschichte zu werfen, sogar länger zurück. Wenn wir uns den Preisanstieg seit 2008 anschauen, müssen wir feststellen, ab und zu sind die Zahlen hinter den Konsensus zurückgeblieben. Die Entscheidungsträger und sogar die Ökonomen haben immer wieder das Zeitfenster verschoben, in dem sie die Inflationsrate vorhergesagt haben. Doch diese Erwartung wurde nie wahr. Es gibt mehrere Gründe dafür. Der eine ist, dass bis zum 2008 die Welt eine relative lange Glückperiode erlebt hatte, mindestens in dem Sinne, dass sie in der Wirtschaftsgeschichte ganz einzigartig und außergewöhnlich war, auch in den darauf folgenden Konsequenzen. Bis 2008 lief es parallel ein Kreditblase und zugleich eine Energieblase, die am Ende galoppierende Preise mit sich gebracht hatten. Das Platzen der Blasen hatten dazu geführt, dass wir riesige Kapazitäten an Energie und allen anderen Produkten übrig hatten, die als Reaktion auf das höhere Preisniveau nach und nach aufgebaut worden waren und uns später zur Verfügung standen. Nicht nur im Bereich Energie, sondern auch bei Technologie und Dienstleistungen. Das hat noch heute Auswirkungen: die Nachfrage in der Wirtschaft konnte lange das Niveau Angebots nicht aufholen. Mit anderen Worten konnte die Realwirtschaft eine Weile nicht zu seinen Kapazitäten heranwachsen. Aber auch andere Faktoren haben seit 2008 durch die technologische Fortschritt und Veränderung der Konsumverhalten eine wichtige Rolle gespielt. Diese Entwicklung war großenteils die Ausbreitung der globalen Online-Systeme, die Globalisierung selbst, die die Vergleichbarkeit der Preise enorm verbessert hat. Infolgedessen waren all die Marktakteure von Verbrauchern bis zu Herstellern in der Lage, wirksamere Entscheidungen zu treffen. Das Phänomen hat einfach eine viel effizientere Verteilung ermöglicht. Dies hat den globalen Wettbewerb erhöht und die Produktpreise sowie Dienstleistungskosten niedrig gehalten.
Mittlerweile ist auf Makroebene solch ein hohes Wachstum beim Konsum, das wir vor 2008 erlebt hatten, noch nicht zurückgekehrt. Von der Seite der Unternehmen beobachten wir ebenso eine schwächere Aktivität von Investitionen in Betriebskapital, was zu den allgemein geringerer Nachfrage in der Realwirtschaft ebenfalls beigetragen hat. Darüber hinaus treibt die Niedrigzinspolitik die Geldanlagen eher in Kapitalmärkte als in Realinvestitionen, daher bleibt der Preisdruck relativ gering, während all die Kursen in den Märkten in die Höhe geschossen sind sowie bei Immobilien. Das Kapital geht in die Märkte und nicht in die Wirtschaft. Das treibt die Kursen global weiter nach oben und fast jeden Tag werden Rekorde geknackt. Da die Inflationsindikatoren keine Asset-Preise nur Verbrauchpreise umfassen, reagieren die Zentralbanken nicht. Sie kurbeln die Ereignisse sogar weiter an, dadurch dass sie wegen des relativ schwachen GDP-Wachstums ungestört von der anscheinend niedrigen Inflation lockere Geldpolitik fortsetzen.
R: Der Basiseffekt der Energiepreise hinsichtlich der aktuellen Inflation scheint zu Ende zu gehen. Welche Faktoren können dann die Konsumpreise weiter erhöhen?
K.S-Sz.: Es gibt Hinweise darauf, meistens in den USA und Europa, dass der Druck auf Preisen aufgrund der wohl bekannten Zusammenhänge aus den letzten 100 Jahren theoretisch zunimmt. Der eine: die Zuwachsrate der Löhne überholt die Produktivität schon lange. Der andere: die Geldmenge wächst stärker als die Produktionskapazität. In den USA hat der von der FED beobachtete Preisindex für persönliche Konsumausgaben den höchsten Stand seit vier Jahren erreicht, in Deutschland ist die Inflation so hoch wie seit 2012 nicht mehr.
Die Unternehmen stellen jedoch keineswegs haufenweise Mitarbeiter ein. Zumindest nicht in allen Sektoren. Gesamt- und Medianlöhne stiegen nicht annähernd so steil wie in den 2000er Jahren, sondern finanzieren die Firmen meistens Aktienrückkaufprogramme und Dividend-Ausschüttung. (Seit 2009 sind die Rückkaufprogrammwerte um 194%, die Dividende um 67% gestiegen, während Investitionen lediglich 44% zulegten. Quelle: Carlyle Group). Dieser Trend kann noch in der näheren Zukunft anhalten. Wo die Inflation jedoch ins Spiel kommen kann, ist nicht nur die Nachfrage, sondern auch die Angebotsseite: die neue populistische Politik, die immer wieder mit Protektionismus und Tarifen steuert. Dies, selbst wenn nicht im Ausmaß von Venezuela, könnte sogar Störungen in der Preispolitik der Firmen bewirken. Die Abschottungsmethoden machen die Angebotsseite enger und dadurch die Produkte teurer, was von Dauer sein kann. Hier droht dann das Schrecken: Stagflation. Das Wirtschaftswachstum unter Durschnitt Zeit zu Zeit mit galoppierender Inflation, die den Spielraum der Notenbanken beschränken würde. Es ist aber sehr schwer, das Zeitfenster und den Ablauf dieses Prozess genau vorherzusagen.
R: Gibt es eigentlich überhaupt ein ideales Niveau für Inflation?
K.S-Sz.: Das ist eine gute Frage, weil ich es auch für nötig halte, den Ansatz der Entscheidungsträger zu ändern und das ganze Zielsystem zu reformieren. Heute schaut die Wirtschaftsstruktur anders aus als vor 10-20 Jahren. Trotzdem betreiben die Notenbanken dieselbe Geldpolitik und Mandaten wie früher. Das Problem liegt nicht nur darin, dass sie den Prozessen hinter geblieben sind, sondern andere Parameter wie Verschuldungen haben auch neue Rekorde geknickt. Die Gesamtschulden in den USA liegen bei 350%, in China bei 370%, in den Eurozone bei 470% und in Japan bei 615% im Vergleich zu GDP. Und hier geht es nicht um die absolute Höhe der Verschuldung, denn diese Menge von Geld großenteils befindet sich natürlich auf der anderen Seite, bei den Debitoren und anderen Akteuren als Ersparnis oder Vermögen. Also heißt es nicht, dass das Kredit vom Marsch zurückzuzahlen ist. In dieser Hinsicht ist es daher ein reines Nullsummenspiel. Das Problem ist, dass die Ungleichheit und Ungleichgewicht enorm zugenommen haben. Und dieses Phänomen in der Gesellschaft wurde in den letzten 30 Jahren auch immer wieder von der Politik unterschätzt. Doch kam dann der Volksaufstand, die Unzufriedenheit schlug gegen die Wand, und schließlich brachen Brexit und Donald Trump durch. Reagieren die Entscheidungsträger nicht angemessen, erreicht dieses Ungleichgewicht auch auf den Finanzmärkten ein Ausmaß, wo hektische Ereignissen rasch stattfinden und zum Chaos führen können. Es ist nicht absehbar, wie sich dies genau auf die Inflation auswirken wird, aber ich glaube, wir nähern uns einer Epoche, in der auf Phasen niedriger Inflation die Periode höherer Preisanstiege immer häufiger folgen.